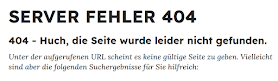In Wiesbaden gab es im Jahr 2025 eine Aktion zur Sammlung von Daten, während man mit dem Fahrrad durch die Stadt radelt. Diese Aktion hatte ich hier schon einmal beschrieben: Rad fahren und Daten sammeln. Die Aktion ist abgeschlossen, jetzt beginnt die Auswertung der Daten und natürlich auch die Aufarbeitung der Aktion.
Das ist eine Übersicht über die von fleissigen Radlern zurückgelegten Strecken:
Sie finden den Hinweis auf diese Aktion hier: Datenwelt: Fahrradnutzung in Wiesbaden. Und da fange ich auch gleich mit meiner Kritik an: Warum benötigt man auf dieser Seite achtmal diesen immer gleichen Hinweis:
Es spielt auch keine Rolle, auf welchen Button Sie klicken, um die Erlaubnis zu erteilen, denn es kommt immer die gleiche Seite.
Einbettung
Auf dieser Seite bietet die Stadt Wiesbaden freundlicherweise an, daß man über diese Aktion auf eigenen Seiten im Internet berichten kann, so wie ich das hier mache. So kann man einen Link auf diese Seite in einen eigenen Text einbetten, aber auch direkt auf die Kachel verweisen. Also nehme ich dieses 'Angebot' an. So sieht das dann aus:Ich habe 1-zu-1 den angebotenen HTML-Code hier in meinen Text eingebettet. Also so richtig gelungen ist das auch nicht. Also zeige ich Ihnen die Kachel in voller Schönheit:
Auf diesem Bild sehen Sie die im Magistrat für diese Aktion verantwortlichen Mitglieder, Frau Koohestanian und Herr Kowol. Von beiden Personen gibt es ein kurzes Statement zum Thema Radfahren. Rechts in der Ecke unter den Statements finden Sie einen Hinweis: Mehr Details. Wenn Sie auf der Originalseite auf diesen Hinweis klicken erscheint der gleiche Text, aber diesmal in weißer Schrift vor blauem Hintergrund. Mehr Details heißt also, daß sich die Farbe ändert, an den Sätzen ändert sich nichts, und somit erhalten Sie auch keine weiteren Informationen. Tja.
Erfolge
Noch etwas weiter unten auf dieser Seite kommen Sie dann zur Aktion "SensorBike". An dieser Aktion habe ich teilgenommen und war einer von 30 Personen, die am Rad diese Box befestigt hatten und damit gefahren sind. So sieht das aus nach Ende der Aktion:Ist doch beeindruckend, wieviele Kilometer die Teilnehmer an dieser Aktion geradelt sind. Und ich war einer der Teilnehmer.
Im Jahre 2025 bin ich etwa 650 km geradelt. Vorgenommen hatte ich mir zwar 1.000 km, aber irgendwie war ich diesmal nicht so ehrgeizig. Von diesen 650 km bin ich etwa 500 km mit der Box am Rad gefahren.
Über 5.000 km wurde von den Teilnehmern an dieser Aktion geradelt. D.h. ich wäre alleine für fast 10% der Strecke verantwortlich, und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich bin nicht der große Radler in Wiesbaden, aber diese Zahl vermittelt einen anderen Eindruck. Also irgendwie mag ich diese Zahl ca. 5.000 km nicht glauben.
Auf dieser Seite kann man sich neben der Gesamt-Distanz der Aktion auch ansehen, wieviele Kalorien die Teilnehmer in etwa "verbrannt" haben. Aber ach, so sieht das aus:
Können Sie erkennen, wieviel Kilokalorien von den Teilnehmern da verbraucht wurden? Und wie wurde das gemessen? Manche Teilnehmer hatten eBikes, andere traditionelle Räder, da wird unterschiedlich viel Kraft benötigt.
Details
Zu Beginn dieser Seite hatte ich ein Bild eingefügt, das die gefahrenen Strecken in Wiesbaden und Umgebung darstellt. Im Original kann man dieses Bild auch vergrößern und sich an einzelnen Punkten die dort gemessenen Werte anzeigen lassen. So sah das an einer zufällig ausgewählten Strassenecke aus:Wie Sie sehen, sehen Sie - nichts. Pech gehabt, einen Punkt erwischt, wo keine Daten vorliegen. Andere Punkte zeigen Ihnen Daten an, aber es gibt viele Punkte ohne Daten.
Und diese Daten will man für die Verkehrsplanung in Wiesbaden verwenden.
Ich würde Ihnen gerne den Link zu dieser Seite hier angeben, aber mir ist die Rechtslage nicht klar. Hier handelt es sich um Daten und Auswertungen der Stadt Wiesbaden und ich möchte keinen Rechtsstreit mit der Stadt Wiesbaden riskieren. Schöne Worte hin oder her, ich will da vorsichtig sein.
Ich bleibe beim Thema und komme zum nächsten Punkt.
Open Data
Das Projekt steht unter den Schlagworten Citizen Science und Open Data. Und zu Open Data schreibt Wikipedia:Definition
Offene Daten sind sämtliche Datenbestände, die im Interesse der Allgemeinheit der Gesellschaft ohne jedwede Einschränkung zur freien Nutzung, zur Weiterverbreitung und zur freien Weiterverwendung frei zugänglich gemacht werden. Die wissenschaftliche Literatur zitiert beispielhaft Lehrmaterial, Geodaten, Statistiken, Verkehrsinformationen, wissenschaftliche Publikationen, medizinische Forschungsergebnisse oder Hörfunk- und Fernsehsendungen. Bei Open Data kann es sich über Datenbestände staatlicher Stellen hinaus auch um Daten privatwirtschaftlich agierender Unternehmen, Hochschulen sowie Non-Profit-Einrichtungen handeln.
Quelle: Text zu Open Data in der Wikipedia
Die Daten der Boxen, also auch die von mir erhobenen Daten, werden an die Seite openSenseMap gesendet. Auf dieser Karte können Sie als Suchbegriff YDM eingeben, denn das ist Kennung meiner Box. Danach sehen Sie dieses:
Sie sehen die Daten der letzten Messung, die auch schon etliche Wochen zurück liegt. Und die anderen Werte? Ich bin etwa 500km mit dieser Box geradelt, da müssten mehrere Tausende Datensätze vorliegen. Und was ist mit den Datensätzen der übrigen 29 Teilnehmer an dieser Aktion?
Im Rahmen von Open Data müssten alle diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Dann könnte man eigene Auswertungen erstellen und wäre nicht auf von Seiten der Stadtpolitik erstellte Grafiken angewiesen.
Feinstaub
In der Vergangenheit war Feinstaub ein Thema auf diesem Blog, insbesondere die Belastungen mit Feinstaub in Wiesbaden. Früher drohten Fahrverbote wegen Feinstaub (und Stickoxiden) in Wiesbaden, aber auch in anderen Städten. Mittlerweile ist dies aber besser geworden, in Wiesbaden und an anderen Orten.Die Box misst Feinstaub in den Größen PM 101), PM4, PM2.52) und PM1. Deswegen gibt es auch dazu Daten, die man in Kartenform darstellen kann. Hier haben Sie solch ein Bild der Innenstadt:
Auch hier kann man sich Details ansehen und sieht dann so etwas:
Ein Wert von 115 µg/m³ ist schon heftig. Hier sollte man genauer hinsehen, aber die Seite lässt es zwar zu, daß man sich Details anzeigen kann, aber die zugrundeliegende Strasse kann man dann nicht mehr erkennen. Aus den Rohdaten kann man sicherlich mehr erkennen, aber ich habe den Verdacht, daß es sich hier um einen Meßfehler handelt. Die übrigen Sechsecke zeigen ziemlich gute Werte an, bis auf ein paar Ausrutscher, die aber auch harmlos sind.
Und eine Anmerkung am Rande möchte ich noch vortragen: eine Zahlendarstellung mit 7 bis 14 Nachkommastellen für solche Meßwerte bewerte ich als Pseudogenauigkeit. Wie hoch ist denn die Meßgenauigeit des Sensors in der Box? Bei einer Toleranz von 1% ist die 5 in der Zahl 115 schon kritisch, was sollen dann alle weiteren Ziffern? Der in meinen früheren Artikeln angegebene Sensor (Typ SDS011) hat eine Meßgenauigkeit von 10%, da ist die Stelle vor der 5 schon mit Vorsicht zu betrachten.
Weitere Auswertungen
Aus den während der Fahrt erhobenen Daten kann man weitere Auswertungen vornehmen:- Stillstand
- Anzahl Messpunkte in einem Strassenabschnitt
- Anzahl Boxen in einem Strassenabschnitt
- Überholvorgänge
- Oberfläche der Strasse
- usw.
Auch an diesen Punkten wurden Auswertungen gemacht. Ich möchte davon nur ein Beispiel herausgreifen: Sofern ein Auto ein Rad mit angeschlossener Box überholte, wurde von der Box der Abstand zwischen Auto und Fahrrad gemessen und vom Handy dann Ort und Abstand an den Server gesendet. Dies scheint aber nicht so richtig zu funktionieren, wenn es sich um ein schwarz lackiertes Auto handelt (man könnte sagen, daß Cars of Color marginalisiert werden).
Aber da meine Anmerkungen analog zu den bereits vorgetragenen Argumenten sind, möchte ich auf die Aufzählung weiterer Kritikpunkte verzichten.
Mails
Im Rahmen dieses Projekts erhielt ich von der Stadt Wiesbaden mehrere Mails. Auffällig daran ist, daß diese Mails durchaus auch mal mit offener Empfängerliste versendet wurden. Hier ein Ausschnitt aus solch einer Mail:To: "Txxxxxxx, xxxx" <Nxxxxxxxxxxxx@wiesbaden.de>,
"Sxxxxxxxxxxxxxx" <Sxxxxxxxxxxxxx@wiesbaden.de>,
"nxxxxxxxxx@gmail.com" <nxxxxxxxxx@gmail.com>,
"bxxxxxx@adfc-wiesbaden.de" <bxxxxxx@adfc-wiesbaden.de>,
"lxxxxxxxxxx@von-garnier.com" <lxxxxxxxxxx@von-garnier.com>,
"mxxxxxxxxxxxxxx@web.de" <mxxxxxxxxxxxxxx@web.de>,
"Nxxxxxxxxxxxxxxxxx@hs-rm.de" <Nxxxxxxxxxxxxxxxxx@hs-rm.de>,
"hxxxx@web.de" <hxxxx@web.de>,
........
Subject: Sensor Bike | Gemeinsamer Blick auf die Daten (online
Insgesamt hat diese Mail über 30 Empfänger.
Dies ist ein klarer Verstoss gegen den Datenschutz, der mit einer Geldstrafe belegt werden kann. Fragen wir doch mal eine KI zu diesem Thema:
Und aus diesem Grund habe ich in der Aufstellung hier in diesem Text die Namen der Empfänger durch x ersetzt, sonst mache ich mich einer Verletzung der DSGVO schuldig.
Solche Mails mit offener Empfängerliste sind für die Stadt Wiesbaden kein Problem. Vor etwa einem Jahr hatte ich dieses Thema im Rahmen der Bürgerfragestunde (Oh Gott, eine Frage eines Bürgers) im Ausschuss für Wirtschaft angesprochen, da ich in Kopie eine Mail mit über 300 Empfängern auf einer offenen Empfängerliste erhalten hatte. Naja, im Ausschuss gab es eine kleine Diskussion dazu. Diese Diskussion wurde damit beendet, daß man erst einmal den Sachverhalt prüfen müsse. Und danach habe ich nie wieder etwas davon gehört. Und Konsequenzen hatte es offensichtlich keine.
Hätte ich im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit eine solche Mail versandt, hätte ich aber am nächsten Tag beim Chef auf dem Teppich gestanden.
Fazit
Genug für heute.Dies ist halt ein Projekt in der Stadt Wiesbaden, da sollte man keine so hohen Ansprüche haben. Mit solchen Ergebnissen müssen wir als Bürger der Stadt Wiesbaden zufrieden sein, denn sie können es nicht besser. Und niemand beschwert sich. Alle loben das Engagement der Stadt Wiesbaden. So auch in diesem Projekt.
Anmerkungen: